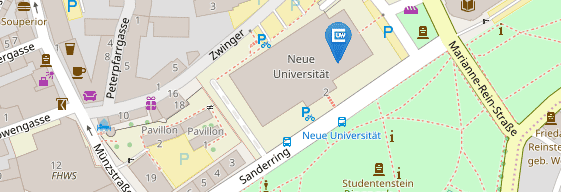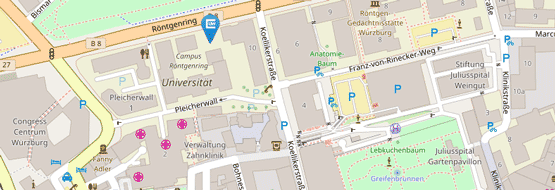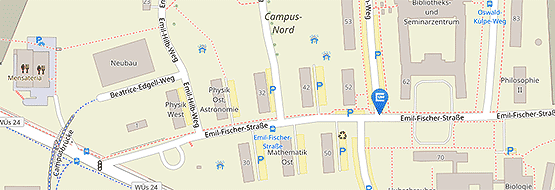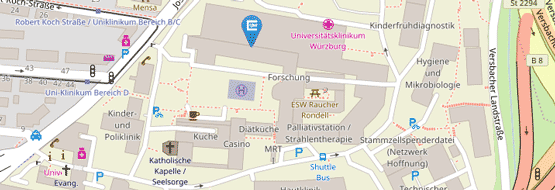Von Würzburg in die Welt
14.01.2020Katja Becker ist von 2020 an Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Einen Teil ihrer Karriere hat sie am Zentrum für Infektionsforschung der JMU absolviert – eine Zeit, die sie als große Bereicherung bezeichnet.

Was arbeiten Absolventinnen und Absolventen der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU)? Um den Studierenden verschiedene Perspektiven vorzustellen, hat Michaela Thiel, Geschäftsführerin des zentralen Alumni-Netzwerks, ausgewählte Ehemalige befragt. Diesmal ist Prof. Dr. Katja Becker an der Reihe.
Becker hat Medizin studiert und an der Universität Würzburg in der Infektionsbiologie eine Arbeitsgruppe geleitet. Sie hat Forschungsaufenthalte in Australien, Großbritannien, Ghana, der Schweiz, Nigeria und den USA absolviert. Im Juli wurde sie zur Präsidentin der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gewählt und tritt dieses Amt im Januar an.
Frau Prof. Becker, warum haben Sie sich für Ihr Fach entschieden? Was fasziniert Sie besonders daran? Bereits in der Schule wollte ich Medizin studieren. Der Hippokratische Eid hat mich beeindruckt, und das Engagement für Menschen in Not war mir ein großes Anliegen. Aber auch das Handwerkszeug diagnostischer und therapeutischer Möglichkeiten fand ich faszinierend. Ich war dann von Psychosomatik und Herzchirurgie begeistert sowie bereits früh von der Infektionsforschung. Infektionserreger, seien es Viren, Bakterien oder Parasiten, sind aus evolutionärer Sicht sehr früh entstanden und, obwohl sie so klein sind, fordern sie uns Menschen bis zum heutigen Tag heraus. So ist die Geschichte der Menschheit in der Tat eine Geschichte des Hungerns und der Infektionskrankheiten. Als angehende Ärztin war ich oft in Ländern des Südens unterwegs und habe den Schrecken schwerer Infektionen gesehen. So entschloss ich mich für eine Promotion und später Habilitation im Bereich der Malariaforschung. Damals bereits dachte ich, es könnte gut sein, diese Arbeiten durch wissenschaftspolitisches Engagement zu unterstützen, und so schließt sich nun in gewisser Weise ein Kreis für mich. Hierfür bin ich sehr dankbar und freue mich sehr darauf.
Sie haben einige Auslandsaufenthalte absolviert. Welches war Ihr Lieblingsland und warum? Auf welche Weise unterschied sich das Forschen und Arbeiten in diesem Land vom Forschen und Arbeiten in Deutschland? Alle Länder, in denen ich arbeiten durfte, haben mich fasziniert. Jede Landschaft, jede Kultur birgt Einzigartiges. Besonders spannend war die Zeit, die ich als angehende Ärztin mit dem Royal Flying Doctor Service in Zentralaustralien verbringen durfte. Oft waren wir in den Regionen unterwegs, die von australischen Ureinwohnern besiedelt waren – diese Arbeit fand ich unglaublich wichtig und sie hat mich sehr gefordert. Weil mein Urgroßvater vor über hundert Jahren Missionar in Australien war und meine Großmutter dort geboren wurde, fühle ich mich diesem weiten, heißen und roten Land zusätzlich sehr verbunden. Faszinierend ist es aber auch, am Scripps Research Institute in La Jolla, Kalifornien, zu arbeiten und die Wale vorbeiziehen zu sehen, wenn man aus dem Fenster schaut. Hier forscht man natürlich auf höchstem wissenschaftlichen und technischen Niveau. Außerdem kann man sich hervorragend mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt vernetzen. Und als Malariaforscherin kann ich meine große Liebe zu Afrika natürlich nicht verbergen. Dies gilt für die Menschen – noch immer sterben jedes Jahr fast eine halbe Million Menschen, meist Kinder unter fünf Jahren, an Malaria – aber auch für die Tier- und Pflanzenwelt und die atemberaubende Schönheit der Landschaft. Die Arbeit in afrikanischen Kliniken ist heute noch vielerorts sehr schwierig. Auch wenn die Situation sich langsam bessert, so sind doch die Infrastruktur vor Ort sowie die Verfügbarkeit von Materialien und Medikamenten oft bedrückend schlecht. Ich bin daher froh, dass wir viele Doktorandinnen und Doktoranden aus Afrika bei uns im Labor ausbilden konnten und dass ich mit einer ganzen Reihe sehr engagierter Kolleginnen und Kollegen aus Afrika zusammenarbeiten darf.
Sie sind die erste Präsidentin der DFG und engagieren sich als Mentorin für junge Akademikerinnen. Inwiefern spielt das „Weiblich-Sein“ aus Ihrer Sicht in der Wissenschaft und Forschung eine Rolle? In der Wissenschaft wird zum Glück immer weniger zwischen Männern und Frauen unterschieden. Wer gute Wissenschaft macht und gute Ideen hat, wird auch anerkannt. Gleichzeitig sind wir leider noch immer weit davon entfernt, genauso viele Lehrstühle und Spitzenpositionen mit Frauen wie mit Männern zu besetzen. Das ist schade, denn wir wissen ja inzwischen, dass gemischte Teams – auf allen Karrierestufen – besser funktionieren, und dies sollten wir auch der Wissenschaft nicht vorenthalten. Um dies zu verbessern, müssen wir alle noch konsequenter umdenken und wir müssen in dem Moment da sein, in dem junge Wissenschaftlerinnen uns brauchen, um ihre Karriere fortführen zu können. Dieser Moment und die jeweiligen Umstände sind individuell sehr unterschiedlich, und Frauen sind nach wie vor im familiären Umfeld stärker engagiert als Männer. Von daher brauchen wir hier noch größere Flexibilität um wirksam unterstützen zu können – die Logistik und das Selbstbewusstsein.
Sie engagieren sich schon länger als Vizepräsidentin in der DFG. Was reizt Sie besonders an Ihrer neuen Aufgabe und wo sehen Sie besondere Herausforderungen für die Forschungsförderung und die wissenschaftliche Selbstverwaltung? Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe, insbesondere darauf, viele Prozesse in der deutschen Wissenschaftslandschaft mitgestalten zu können, aber auch auf die Menschen, die ich treffen und mit denen ich zusammenarbeiten werde. Ich denke, dass auf die DFG in den nächsten Jahren viele Herausforderungen zukommen werden. Diese betreffen beispielsweise die Wahrnehmung der Wissenschaft in der Gesellschaft, die Freiheit von Wissenschaft, die Freiheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und folglich viele Aspekte der Wissenschaftskommunikation. Sie betreffen aber auch die zunehmende Digitalisierung der Wissenschaften und die Tatsache, dass viele Forschungsprojekte nur noch in internationalen Kooperationen durchgeführt werden können und wir dafür über neue Förderformate nachdenken müssen. Aber auch bestehende Förderprogramme müssen regelmäßig auf den Prüfstand gestellt und an die Bedarfe der Wissenschaft angepasst werden. Insgesamt werde ich mich besonders für Kommunikation und Zusammenarbeit, innerhalb Deutschlands, aber auch mit unseren Partnern im Ausland engagieren. Um den Herausforderungen unserer Zeit begegnen zu können, müssen wir alle an einem Strang ziehen und wir alle müssen lernen zu teilen.
Was würden Sie als Ihre schönste Erinnerung an Ihre Würzburger Zeit bezeichnen? Die Weinberge im Herbst sind spektakulär, die Gastfreundschaft ist wundervoll und es war für mich beruflich wie auch persönlich jeden Tag eine große Bereicherung am Zentrum für Infektionsforschung der Universität arbeiten zu dürfen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sie sind selbst noch nicht Mitglied im Netzwerk der Universität? Dann sind Sie herzlich eingeladen, sich über www.alumni.uni-wuerzburg.de zu registrieren! Hier finden Sie auch die bislang veröffentlichten Porträts von Alumni und Alumnae der JMU.