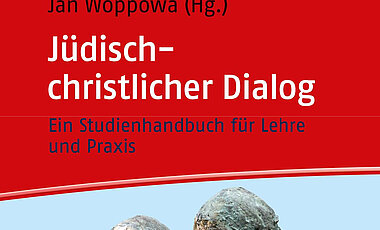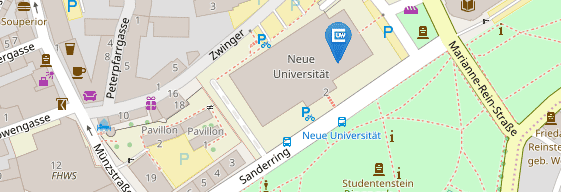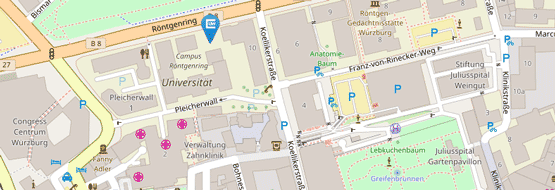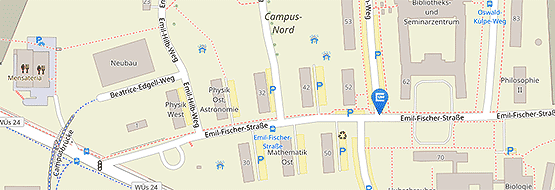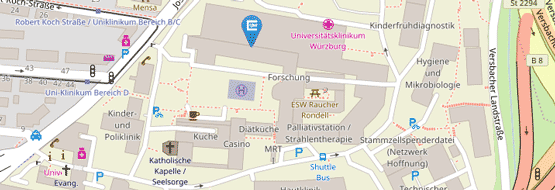Zum Dialog zwischen Juden- und Christentum
04.06.2024Ein Studienhandbuch soll Perspektiven und Antworten rund um den Dialog zwischen den beiden Religionen liefern. Herausgegeben hat es die Würzburger Theologieprofessorin Barbara Schmitz gemeinsam mit zwei Kollegen.

Die Beziehung zwischen Christen- und Judentum ist ebenso komplex, wie sie alt ist. Knapp 60 Jahre ist es her, dass die Katholische Kirche in ihrer Erklärung über die Haltung der Kirche zu den nichtchristlichen Religionen Wahres und Heiliges in diesen anerkannte und sich ihnen so annäherte. Nostra aetate (In unserer Zeit), wird diese Erklärung genannt und erkennt auch die besondere Beziehung zum Judentum an, in dem das Christentum wurzle.
Auch heute braucht es Einsatz und gegenseitiges Verständnis, um den Austausch zwischen den Religionen voranzutreiben. Zu diesem Verständnis soll zukünftig ein Studienhandbuch beitragen, das die Würzburger Professorin Barbara Schmitz gemeinsam mit ihren Kollegen Professor Christian Ruitishauser (Universität Luzern) und Professor Jan Woppowa (Universität Paderborn) herausgegeben hat: Jüdisch-christlicher Dialog – Ein Studienhandbuch für Lehre und Praxis.
Eine Lücke geschlossen
„Die Idee zum Projekt kam Jan Woppowa und mir 2021 im Rahmen unserer gemeinsamen Arbeit in der Unterkommission für die religiösen Beziehungen zum Judentum der deutschen Bischofskonferenz“, erinnert sich Barbara Schmitz. An der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) leitet sie den Lehrstuhl für Altes Testament und biblisch-orientalische Sprachen. Das bisherige Fehlen eines solchen Werkes – und zwar über sämtliche Sprachräume hinweg – hatte beide überrascht. Schnell war man sich einigen, „dass man da etwas machen müsse.“
Unterschiedliche Perspektiven
Bei der Erarbeitung des Konzepts war es den Herausgebenden wichtig, ihre Perspektiven offen darzulegen: „Wir sprechen nicht für oder über andere, sondern reflektieren aus Sicht der katholischen Theologie die Bedeutung des jüdisch-christlichen Dialogs für die katholische Theologie.“
Für weitere Perspektiven holte sich das Herausgeber-Trio Expertinnen und Expertin aus unterschiedlichen Fachbereichen ins Boot.
Der erste Teil des Studienhandbuchs besteht aus Grundlagenbeiträgen und soll „mit ökumenischem Weitwinkel reflektieren“, so Barbara Schmitz. Neben katholischer, evangelischer und jüdischer Perspektive auf den Dialog enthält er auch Texte zu Antijudaismus und Antisemitismus. Auch der Staat Israel sowie israelbezogener Antisemitismus werden thematisiert.
Gerade letzterer war den Herausgebenden ein wichtiges Anliegen: „Israelbezogener Antisemitismus ist ein relativ neues Phänomen. Es geht hier etwa um Fälle, wo Menschen vermeintlich ‚nichts gegen Juden haben‘, darauf jedoch ein ‚aber…‘ folgen lassen. Die Frage ist also: Was kommt nach dem ‚aber‘?“, erläutert Barbara Schmitz. In diesem Bereich kommt auch der sogenannte 3D-Test zum Einsatz. Die drei D’s – Dämonisierung, Delegitimierung und doppelte Standards – sollen dabei helfen, Antisemitismus von legitimer Kritik an der Politik des Staates Israel zu unterscheiden.
Der Dialog als Querschnittsthema
Der zweite Teil des Studienhandbuchs befasst sich damit, wie der jüdisch-christlicher Dialog verschiedene Disziplinen beeinflusst. „Wir verstehen diesen Dialog nicht als ein Spezialthema, sondern als Aspekt, der sämtliche theologischen Disziplinen betrifft und beeinflusst. Deshalb haben wir den Autorinnen und Autoren die Frage gestellt, wie sie dieses Verhältnis wahrnehmen und welche Impulse ihre jeweilige Disziplin dem Dialog geben kann“, erklärt Schmitz.
Einsatz in der Lehre
Dass ein solches Werk gerade in der heutigen Zeit von großer Wichtigkeit ist, steht für Barbara Schmitz außer Frage: „Eine ehrliche Selbstbilanz der christlichen Kirchen muss sich eingestehen, dass sie über Jahrhunderte diejenigen, die Antijudaismus mit kreiert und befördert haben.“ Mit Nostra aetate stellte sich die katholische Kirche diesem Erbe. Daraus entstehe wiederum Verpflichtungen für die Theologie. „Es gilt, unsere Theologie so zu entwickeln und umzubauen, dass sie keine antijüdischen Stereotypen enthält. Daraus entsteht auch ein ethischer Auftrag als Impuls in die Gesellschaft hinein. Hier sind nicht nur die Kirchen, sondern auch christliche Theologie als akademische Disziplin gefragt“, so Schmitz.
Ein einem Seminar arbeitete die Professorin bereits während der Entstehung mit dem Studienhandbuch und konnte die Inhalte so direkt gemeinsam mit den Studierenden testen. Bei der Buchpräsentation Anfang Mai war ein großer Teil des Programms als Fortbildung konzipiert. Hier galt es, Kooperationspartner etwa auf der Ebene der Lehrerinnen und Lehrer zu finden, um den praktischen Nutzen des Buchs zu garantieren.
Publikation
Christian Rutishauser, Barbara Schmitz, Jan Woppowa (Hrsg.): Jüdisch-christlicher Dialog. Ein Studienhandbuch für Lehre und Praxis. 266 Seiten. 39 Euro. UTB Stuttgart 2024, ISBN 978-3825262594.
Kontakt
Prof. Dr. Barbara Schmitz, Lehrstuhlinhaberin für Altes Testament und biblisch-orientalische Sprachen, Tel: 0931/ 31 86089, E-Mail: barbara.schmitz@uni-wuerzburg.de