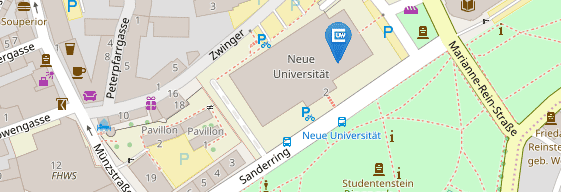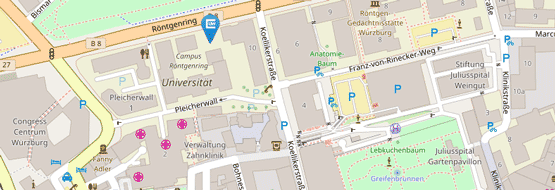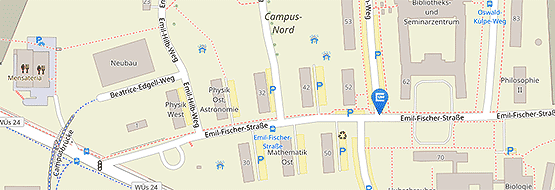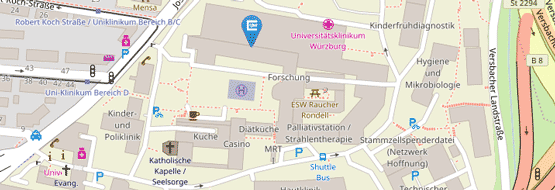Genomstudien: Mehr ist nicht immer besser
14.07.2021Die Eigenschaften von Pflanzen derselben Art können je nach Herkunft unterschiedliche genetisch Ursachen haben. Das zeigt eine aktuelle Studie der Universität Würzburg.

Was für Zoologen die Taufliege, ist für Botaniker die Ackerschmalwand. Das weit verbreitete Kraut mit dem botanischen Namen Arabidopsis thaliana dient ihnen als Modellorganismus, aus dem sich Erkenntnisse für andere Pflanzen gewinnen lassen. Es ist daher äußerst gut erforscht - auch genetisch. So weiß man heute etwa, dass das Erbgut der Ackerschmalwand (ihr Genom) rund 125 Millionen Basenpaare umfasst. Es ist, als hätte man eine Lego-Anleitung vor sich, die 125 Millionen Buchstaben lang ist und alles enthält, was man für den Bau einer Arabidopsis-Pflanze wissen muss.
Ähnlich wie Menschen sind auch verschiedene Ackerschmalwand-Exemplare genetisch in der Regel nicht identisch. Wenn man die Bauanleitung sämtlicher Pflanzen dieser Art vergleichen würde, würde man an rund zehn Millionen Stellen auf Unterschiede stoßen, schätzen Experten. „Wir haben uns nun drei Millionen dieser variablen Stellen im Genom genauer angesehen“, erklärt Arthur Korte, Juniorprofessur für evolutionäre Genomik an der Universität Würzburg. „Und zwar bei fast 900 Arabidopsis-Pflanzen von ganz verschiedenen Standorten in Europa, von Südspanien bis Mittelschweden.“
Für Botaniker sind die Variationen im Genom sehr interessant. Denn sie sorgen dafür, dass sich einzelne Arabidopsis-Pflanzen unterscheiden - dass die eine zum Beispiel besser mit Trockenheit zurecht kommt, die andere dagegen mit Frost. „Zum Teil sind das auch Eigenschaften, die wir ganz gezielt in unsere Kulturpflanzen einbringen möchten“, erklärt Korte. „Dazu müssen wir aber zunächst einmal wissen, welche genetischen Unterschiede mit welchen Eigenschaften der Pflanze zusammenhängen.“
Zuviel Heterogenität schadet
Klassischerweise nutzen Wissenschaftler dazu eine Methode, die unter dem Kürzel „GWAS“ (genomweite Assoziationsstudie) firmiert. Dabei nehmen sie das Erbgut Tausender Pflanzen unter die Lupe und suchen nach Änderungen der genetischen Bauanleitung, die besonders häufig mit bestimmten Eigenschaften assoziiert sind, zum Beispiel einer besseren Dürre-Resistenz. Je mehr Exemplare man so vergleicht, desto stärker sollten solche Verbindungen zwischen Genotyp (der individuellen genetischen Bauanleitung) und Phänotyp (den Eigenschaften der jeweiligen Pflanze) ins Auge stechen.
„Wir konnten in unserer Studie aber zeigen, dass das nicht unbedingt so ist“, betont Korte. „Stattdessen ist es manchmal besser, sich auf weniger Exemplare zu beschränken, die dafür aber alle aus einer ähnlichen Gegend kommen.“ Der Grund dafür: Pflanzenpopulationen, die an Standorten mit sehr unterschiedlichen Bedingungen wachsen, unterscheiden sich in ihrem Genom oft erheblich. Diese Heterogenität kann dafür sorgen, dass eine Eigenschaft wie die Dürreresistenz an einem Standort ganz andere genetische Ursachen hat als an einem anderen. „Wenn eine GWAS viele Pflanzen mit sehr großer genetischer Heterogenität umfasst, können ihr daher wichtige Assoziationen zwischen Genotyp und Phänotyp entgehen“, sagt Korte.
In ihrer Studie konnten die Wissenschaftler diesen Effekt tatsächlich nachweisen. Sie führten dazu einerseits eine GWAS sämtlicher knapp 900 Pflanzen durch. Zusätzlich untersuchten sie aber auch nur Teilpopulationen - zum Beispiel diejenigen Arabidopsis-Exemplare, die auf der südiberischen Halbinsel gesammelt worden waren. „Dabei fanden wir dann genetische Zusammenhänge, die bei der Gesamtpopulation nicht zu sehen waren, weil sie sich dort zu sehr verdünnt hatten“, sagt Korte. „Diese Ergebnisse zeigen, dass sich aus kleineren, genetisch homogeneren Stichproben wertvolle neue Erkenntnisse gewinnen lassen.“ Das gelte übrigens nicht nur für Pflanzen, sondern genauso auch für GWAS beim Menschen.
Lokale Anpassungen beruhen oft auf Änderungen von Gen-Netzwerken
Die Studie liefert zudem interessante Einblicke in die Evolution neuer Eigenschaften: Genetische Anpassungen an lokale Gegebenheiten (zum Beispiel an eine besonders trockene Umgebung) basieren meist nicht darauf, dass sich beispielsweise eine einzelne „Dürre-Erbanlage“ verändert hat und damit wirksamer wurde. Stattdessen betreffen sie häufig Regulator-Gene, die ihrerseits in ganze Netzwerke von Erbanlagen eingreifen. „Diese Regulatoren sorgen dann zum Beispiel für ein besseres Feintuning bereits existierender Stoffwechselwege“, sagt Korte.
Diese Erkenntnis ist auch für die Züchtung neuer Sorten relevant. Früher habe man oft gedacht, man müsse einfach nur ein bestimmtes Gen in eine Zuchtlinie einkreuzen, um dort die gewünschte Eigenschaft zu erhalten. Inzwischen kristallisiere sich aber mehr und mehr heraus, dass Netzwerke sehr vieler unterschiedlicher Erbanlagen für diese Eigenschaft nötig seien. „Wir lernen inzwischen immer besser, solche Netzwerke zu identifizieren“, sagt Korte. „Mit diesem Wissen sollte es zukünftig möglich sein, heutige Kulturpflanzen an neue Herausforderungen wie etwa den Klimawandel anzupassen.“
Publikation
William Andres Lopez-Arboleda, Stephan Reinert, Magnus Nordborg, Arthur Korte, Global genetic heterogeneity in adaptive traits, Molecular Biology and Evolution, 2021; https://doi.org/10.1093/molbev/msab208
Kontakt
Arthur Korte, Juniorprofessur für evolutionäre Genomik am Center for Computational and Theoretical Biology (CCTB) der Universität Würzburg, T: +49 931/31-80361, arthur.korte@uni-wuerzburg.de