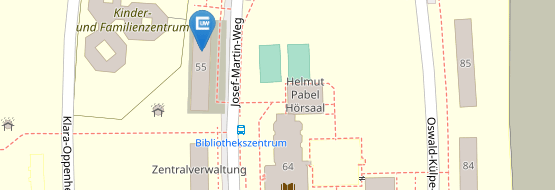Kim Fabienne Hertinger, Psychologie, Regisseurin
05.10.2020Kim Fabienne Hertinger hat an der Universität Würzburg Psychologie studiert und parallel dazu einen Kurzfilm gedreht. Weil der so erfolgreich ist, konzentriert sie sich jetzt auf das Filmemachen. Die Psychologie hilft ihr dabei.

Alumna Kim Fabienne Hertinger hat an der JMU Psychologie studiert. Gleichzeitig hat sie eine Karriere als Regisseurin begonnen und mit ihrem Kurzfilm „Meer bei Nacht“ seitdem viele Preise erhalten. Erst vor Kurzem wurde sie mit dem Kulturförderpreis der Stadt Würzburg ausgezeichnet.
Frau Hertinger, 60 Nominierungen für Festivals und 37 Auszeichnungen haben Sie für Ihren Kurzfilm bekommen. Wie hat sich dadurch Ihr Leben verändert? Ich denke oft an die Zeit zurück, als wir „Meer bei Nacht“ gedreht haben. Alle im Team hatten große Ambitionen und jeder hat sein Bestes gegeben. Es ist viel Arbeit und Mühe in dieses Projekt geflossen. Eine derart positive Resonanz und internationale Aufmerksamkeit hätte aber wohl keiner erwartet, am allerwenigsten ich selbst. Filmemachen war zwar schon immer meine Leidenschaft, doch war „Meer bei Nacht“ das erste professionelle Filmprojekt, das ich auf die Beine gestellt habe. Die zahlreichen Auszeichnungen aus der ganzen Welt und die vielen Menschen, die ich mit dem Film erreichen und bewegen konnte, haben mich dankbarer gemacht und mich darin bestärkt, meinen Weg als Filmemacherin weiter zu verfolgen.
Wie sind Sie auf das Thema Ihres Films gekommen? Ich hatte eigentlich nie vor, ein Thema aus der Psychologie zu der Geschichte meines ersten professionellen Kurzfilmes zu machen. Ich saß eines Tages in einer Vorlesung der klinischen Psychologie. Das Thema war Demenz. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, dass es neben der Alzheimer Erkrankung mehrere Demenzformen gibt. So ging es mir damals auch. In der Vorlesung hörte ich zum ersten Mal vom Korsakow-Syndrom. Dies ist eine spezielle Form der Demenz, die oft in Verbindung mit jahrelangem krankhaftem Alkoholkonsum steht. Anders als bei anderen Demenzformen vergessen die Betroffenen nicht nur Dinge, sondern füllen diese Lücken mit Erinnerungen oder Erlebnissen aus der Vergangenheit, manchmal auch aus der Fantasie. So kann es sein, dass ein Korsakow-Patient, der sich schon wochenlang in stationärer Behandlung befindet, denkt, er würde jeden Tag zur Arbeit gehen. Der Arzt wäre der Chef oder die Krankenpflegerin die Kollegin. Das hat mich sehr beschäftigt. Zu Hause habe ich dann weiter recherchiert und bin auf viele Beiträge von Angehörigen gestoßen. Viele waren in meinem Alter und mussten sich mit Mitte 20 Gedanken über die Pflege von einem Elternteil oder Familienangehörigen machen. Das Korsakow-Syndrom wurde bisher noch nicht filmisch dargestellt. Ich wollte mit „Meer bei Nacht“ einen Versuch wagen, diese komplexe Erkrankung für andere Menschen verständlicher und zugänglicher zu machen.
Und das ist Ihnen definitiv gelungen. Was sind Sie im Moment mehr: Psychologin oder Regisseurin? Der Erfolg von „Meer bei Nacht“ hat mir so manche Türen geöffnet. Ich arbeite derzeit als freie Film- und Medienproduzentin, hauptsächlich in der Werbebranche. Ich verbringe also den Großteil meiner Arbeitszeit als Filmemacherin. Dennoch kommt auch die Psychologin in mir hin und wieder zum Vorschein. Hinter jedem guten Drehbuch stehen glaubhafte Charaktere und Persönlichkeiten, und auch in der Werbung gibt es viele Dinge zu beachten, wenn man möglichst viele Zuschauer erreichen möchte. Hier greife ich dann gerne auf meine Kenntnisse aus der Psychologie zurück. Auch bei der Kommunikation mit Schauspielern und bei schwierigen Verhandlungen mit Kunden hat mir die "innere Psychologin" schon das ein oder andere Mal geholfen.
Sie waren bereits vor Ihrem Studium im Filmbereich tätig. Warum haben Sie trotzdem Psychologie studiert? Ich war schon als Kind von Filmen besessen. Durch das Theater kam ich dann letztlich dazu, mich für den Aufbau von Stücken und Szenen zu interessieren. Was als Hobby begann, wurde immer mehr zur Leidenschaft. Kurz vor meinem Abitur im Jahr 2010 habe ich mein erstes Kurzfilmdrehbuch geschrieben und dieses im Rahmen eines Schulprojektes verfilmt. Wir konnten mit dem Film sogar einen Filmpreis in Frankreich gewinnen. Das hat mich motiviert weiter zu machen und ich ging anschließend für einen Sommerkurs auf die London Film Academy, wo ich das erste Mal internationale Erfahrungen sammeln konnte.
Das klingt eigentlich nach einem geraden Weg in die Filmbranche. Eigentlich ja. Dort habe ich aber auch mitbekommen, wie hart und umkämpft das Filmbusiness ist. Nur die Wenigsten, egal ob vor oder hinter der Kamera, schaffen es, ausschließlich von der Filmarbeit leben zu können. Deshalb wurde mir schnell klar, dass ich einen Plan B brauche. Eine Filmhochschule kam für mich damals nicht in Frage, da ich dafür noch nicht ausreichend Erfahrungen gesammelt hatte. Die Plätze dort sind streng limitiert, und es nicht sehr einfach dort rein zu kommen. Selbst heute hätte ich wahrscheinlich noch schlechte Karten.
Und weshalb haben Sie sich dann für die Psychologie entschieden? Ich habe überlegt, was für mich ein sinnvolles Studium wäre. Psychologie war für mich immer schon mehr als das klassische Diagnostizieren von mentalen Störungen. Die Erforschung von Verhalten und Motivationen hat mich sehr interessiert und ich dachte mir, dass mir das im besten Fall auch dabei hilft, bessere Filme zu machen, was sich ja dann tatsächlich mit „Meer bei Nacht“ gezeigt hat.
Was lieben Sie besonders am Fach Psychologie? Die Psychologie unterscheidet sich von anderen Wissenschaften, wie beispielsweise der Medizin oder der Biologie. Sie ist wissenschaftlich fundiert, doch sind die Leiden der Patienten meist nicht greifbar. Eine Depression ist nicht so sichtbar wie ein Tumor, aber dennoch ist sie da. Menschen mit psychischen Krankheiten werden häufig noch verurteilt und ihre Krankheiten kleingeredet. Das habe ich auch durch die Recherchen für meinen Film gemerkt. Viele Betroffene und Angehörige fühlen sich alleine in ihrer Situation. Die Psychologie und ihre Behandlungsmethoden greifen hier ein und besitzen die Möglichkeit, den Menschen zu helfen.
Und was fasziniert Sie besonders am Filmemachen? Am Filmemachen fasziniert mich der Moment, in dem im Schnitt Bild, Ton und Musik zusammenfinden und so eine Einheit, eine Szene, bilden. Je nachdem welche Parameter man ändert, so ändern sich automatisch auch die Stimmung und die Botschaft. Gut aufeinander abgestimmte Parameter ergeben eine Szene, die die Möglichkeit hat Menschen zu berühren.
Wie sehen aktuell Ihre Zukunftspläne aus? Nachdem „Meer bei Nacht“ ganze zwei Jahre lang auf internationalen Filmfestivals unterwegs war, wurde es Zeit für mich, mich neuen Projekten zuzuwenden. Derzeit schreibe ich mit einem Schauspieler aus München an einem Spielfilm-Drehbuch und arbeite außerdem an eigenen Projekten.
In den vergangenen Monaten hat die Corona-Pandemie die Kunst- und Kulturszene fast völlig zum Stillstand gebracht. Wie hart hat Sie die Coronakrise getroffen? Ich wollte eigentlich dieses Jahr einen neuen Kurzfilm drehen, doch mitten in der Planungsphase kam Corona dazwischen. In Deutschland, wie auch auf der ganzen Welt, wurden Dreharbeiten eingestellt und Fördermöglichkeiten eingefroren. So musste ich schweren Herzens das Projekt erstmal auf Eis legen. Ich möchte die Planungen aber baldmöglichst wieder aufnehmen und den Film spätestens im nächsten Jahr realisieren. Im Mai 2020 sollte außerdem das erste Demenz-Kurzfilmfestival in Kiel stattfinden, bei dem ich im Planungs-Komitee sitze. Zusammen mit der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft wollten wir unter dem Titel „Short Reminder“ uns den unterschiedlichen Betrachtungsweisen von Demenzkranken widmen, sowohl in der filmischen Umsetzung als auch durch Fachbeiträge. Die Veranstaltung wurde in den Herbst 2020 verschoben, und ich hoffe sehr, dass sie stattfindet.
Das heißt, Sie konnten eigentlich gar nicht arbeiten? Nicht ganz. Ich habe immerhin einen kleinen Kurzfilm realisiert, der im Rahmen der Aktion „Kulturpunkte“ des Dachverbandes freier Würzburger Kulturträger präsentiert wurde. Zusammen mit den Autoren Johannes Jung, Pauline Füg, Ulrike Schäfer und der Künstlerin Cendra Polsner haben wir eine multimediale Literaturshow zum Thema „Isolation“ erschaffen. Die Veranstaltung fand am 9. Juni online statt und ist seitdem auf YouTube abrufbar.
Es gibt immer noch sehr viel mehr Regisseure als Regisseurinnen. Haben Sie eine Erklärung für diesen Missstand? Der Regisseur ist der kreative Leiter am Filmset. Er trifft die finalen Entscheidungen über Departments wie Kamera, Licht, Ton und Schauspiel, die meistens ebenfalls noch mit Männern besetzt sind. Regisseur ist ein Beruf, der mit großer Verantwortung einhergeht. Noch größere Verantwortung am Filmset besitzt nur der Produzent, der der organisatorische und finanzielle Leiter des Filmes ist. Hier fällt die Männerquote sogar noch höher aus. Jeder Film bringt einen hohen finanziellen Aufwand und auch ein gewisses Risiko mit sich. Vielen (männerdominierten) Produktionsfirmen fällt es leichter, sich auf einen männlichen Regisseur zu verlassen als auf eine Regisseurin. Natürlich sind das stereotype Denkweisen, die rational nicht haltbar sind. Die Fähigkeit eines Regisseurs hat nicht das Geringste mit dem Geschlecht zu tun. Es gibt keine körperlichen Vorteile, die in diesem Beruf ins Gewicht fallen würden. Deshalb ist es sehr traurig, dass viele begabte Regisseurinnen es so schwer im Filmbusiness haben.
Meinen Sie, das bleibt so? Oder zeichnet sich auch in dieser Branche ein Wandel ab? Natürlich findet momentan auch im Filmgeschäft ein Umschwung statt. Immer mehr weibliche Filmschaffende treten an die Öffentlichkeit heran und machen auf die Probleme in der Industrie aufmerksam. Positive Effekte kann man schon bei den Filmfestivals sehen. Durch „Meer bei Nacht“ konnte ich ja an einigen teilnehmen und habe dort festgestellt, dass oftmals sehr darauf geachtet wird, dass auch Filme weiblicher Regisseure in den Fokus gerückt werden. Ob durch eine Kategorie, ein Thema oder ein ganzes Filmfestival: Viele setzen sich dafür ein, dass Frauen im Filmbusiness mehr Anerkennung für ihre Arbeit bekommen. Es ist natürlich noch ein langer Weg zur Gleichberechtigung, und gerade in den großen Filmindustrien werden wohl noch viele Jahre vergehen, aber ich sehe positiv in die Zukunft und bin sehr stolz, dass ich in diesem spannenden Beruf arbeiten darf.